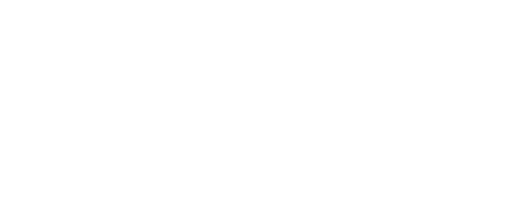Autor: Oliver Gross | Fotos: Oliver Gross
Grundlagentraining Bous und Prüferlehrgang

Aus jedem Training will ich reicher rausgehen, als ich reingegangen bin. Das ist seit Jahren meine Philosophie – egal ob im alltäglichen Training, in befreundeten oder mir unbekannten Dojos oder auf nahen und fernen Lehrgängen.
Umso erfreulicher war der vergangene Samstag an dem das Grundlagentraining Bous unter der Leitung von Roman Adam und Gottfried Graebner endlich wieder in die nächste Runde ging: Die wohlverdiente Sommerpause war vorbei und es wurde ein Tag voller intensiver Technikarbeit, gemeinsamer Reflexion und klarer Positionierung für den Geist des Karates.
Ohne große Ansprache ging es nach einem kurzen, aber herzlichen Willkommen heißen auch direkt los – denn wir stand diesmal nicht die volle Trainingszeit zur Verfügung. Ab 16:30 Uhr stand dafür ein Prüferlehrgang des Saarländischen Karate Verbands auf der Agenda. Also Konzentration und Fokus an und los ging’s.
Der Blick hinter die Technik
Der Auftakt erfolgte über die Kata Jion – Liebe und Güte oder Tempelklang. Also keine Kata, die mit Hau ruck Techniken und Dampfhammer glänzen möchte (auch wenn ich den Otoshi Uke gerne als Hammerschlag Technik erkläre). Heute sollte uns aber eine andere Technik fordern und beschäftigen: Manji Uke.
Von vielen oft als einfache Abwehr trainiert, zeigt sich bei genauerer Betrachtung schnell: Der Manji Uke ist keine Einzeltechnik, sondern eine Kombination, eine Art Kampfsystem innerhalb eines Kampfsystems (wenn wir ehrlich sind, trifft das übrigens auf jede Grundschultechnik zu… Gedan Barai, Age Uke, Shuto Uke, und und und…).
Wir extrahieren also diese Technik aus der Kata und kreieren daraus einen Kihon Ablauf, der einfacher nicht sein könnte: nach vorne, zur Seite, über die Drehung nach hinten, zur Seite und wieder nach vorne. Klingt einfach? Ist es aber nicht. Denn wir Karateka machen gerne mehr als man uns zeigt: Hier mal eine zusätzliche Armbewegung, da mal ein Schritt mehr und hier ein Hin und her der Knie. Dabei müssten wir nur weniger machen… und schon wäre die gesamte Technik effektiver, effizienter und ganz nebenbei auch noch eleganter. Kime und Sanchin im Einklang… oft gehört, oft versucht, oft daran gescheitert.
Also wie kommt man zu einer guten Technik? Grade, wenn sie auch noch vorab demonstriert und erklärt wird?
Hinschauen. Nicht nur sehen, sondern beobachten. Analysieren. Verstehen, was da eigentlich gerade passiert, das Zusammenspiel aller Elemente erfassen und vor allem eine Idee bekommen, was die Technik eigentlich erreichen soll. Dann erst kann ich bewusst daran arbeiten. Und bei Erfolg immer weiter daran feilen.

Entspannung ist der Schlüssel zur Effektivität (und zur Effizienz)
Einer der zentralen Lernpunkte im Karate: Technik braucht Körperbewusstsein – und Entspannung.
Viele Karateka spannen zu früh an oder schlimmer, stehen dauerhaft unter Spannung. Die Bewegung wird dadurch abgehackt, schwerfällig und ineffizient. Erst wenn der Körper locker bleibt – und erst im entscheidenden Moment Spannung aufbaut – entfalt sich die volle Kraft. Die der Technik, nicht der Muskeln.
Dafür spielt auch die Atmung eine wichtige Rolle. Wann atme ich ein? Wann atme ich aus? Wie beeinflusst der Atemfluss meine Bewegung? Körper, Atmung und Technik müssen zusammenarbeiten.
Chinte – Kata in der Praxis erleben
Im zweiten Teil des Trainings wechselten wir zur Kata Chinte (Seltene Hand oder auch Ruhe, Bezwingen). Auch hier wurde nach mehrmaligem Ablauf der Kata gezielt eine Technik(sequenz) herausgegriffen, analysiert, erklärt, geübt und anschließend in Zusammenarbeit mit dem Partner angewandt.
Gerade Chinte – mit ihren rhythmischen, teils ungewöhnlichen Bewegungen – bot eine wunderbare Gelegenheit, sich erneut auf Details und die Zusammenarbeit selbiger zu konzentrieren:
- Was passiert mit der Hüfte?
- Was machen eigentlich meine Schultern die ganze Zeit?
- Welchen Einfluss hat gutes oder weniger gutes Timing auf meine Technik?
- Und was ändert sich, wenn der Partner angreift und ich reagieren soll?
Und genau da wurde es spannend:
Was in der Kata noch halbwegs mühelos aussieht, bricht im Partnertraining oft auseinander. Die Bewegung verändert sich. Muss sich auf die Aktion meines Gegenübers anpassen. Ich muss reagieren. Auf den Angriff. Auf die Geschwingkeit. Auf den Abstand. Oft fällt hier dann alles auseinander, was eben noch halbwegs flüssig wirkte.
Hier zeigt sich: Kata ist keine Choreographie.
Sie ist ein Werkzeugkasten – und erst im Partnertraining versteht man, wofür.
Den Trott durchbrechen
Etwas, dass mir in jedem Training und auf jedem Lehrgang der letzten 20 Jahre und auch heute immer wieder auffällt: Wir trainieren in einem Trott – unserer Komfortzone.
Immer wieder zeigt sich, wie schwer es ist, wirklich in den Aufnahemmodus zu wechseln und Neues zuzulassen.
Der Trainer zeigt eine Anwendung. Die Teilnehmer machen sie ein-, zweimal mit und rutschen dann wieder in ihre gewohnten und regelmäßig trainierten Muster zurück. Nicht aus Trotz, sondern weil das, was man kennt, dann einfach „hervorkommt“. Versteht mich nicht falsch: Man muss und soll auch seine Stärken trainieren, also das, was man schon gut kann. Aber wenn ich gezielt unter einem Trainer trainiere und etwas gezeigt und erklärt wird, was ich noch nicht beherrsche (≠ kenne), dann will ich doch diese neue Sache lernen. Und die wenige, kostbare Trainingszeit nicht damit verbringen, das, was ich ohnehin schon kenne, stumpf abzuspulen.
Aber genau dieser Trott steht dem Lernen, dem Blick über den Tellerrand, im Weg.
Führt irgendetwas (z.B. die Stellung des Angreifers) in der Umsetzung der Aufgabenstellung dazu, dass ich das Aufgetragene nicht mehr anbringen kann, analysisere ich die Situation und mache mit dem weiter, was ich kenne und was funkioniert (trainiere also meine Stärken). Und im nächsten Durchgang verfolge ich wieder strikt die gestellten Aufgabe – mit dem Ziel bis zum Ende der Anwendung zu gelangen.
Denn wenn ich jedes Mal nur das machen, was ich schon kann – wieviel nehme ich dann wirklich mit nach Hause?
Spiegelverkehrt. Rückwärts. Ungewohnt
Wie beginnen die meisten Trainingseinheiten seit mindestens 30 Jahren? Richtig: „Zenkutsu Dachi, links vor, Gedan Barai.“ Sagt man als Trainer dann mal „rechts vor“, stehen anschließend mindestens zwei mit links vor – ganz gleich, ob Kinder, Jugendliche oder Erwachsene.
Verlasse den Trott.
Oft unterschätzt, aber immens wertvoll: Techniken spiegelverkehrt üben.
Kihon und Kata programmiert uns in der Regel stark auf eine Seite (meist links als sichereres Standbein) und schafft Automatismen und Einseitigkeit, die uns unflexibel machen können.
Frage: Kannst du Haishu Uke → Mikazuki Geri → Empi aus der Heian Godan aus dem Stehgreif spiegelverkehrt?
Probier’s aus.
Stell dich in Kiba Dachi rechts vor, streck den Arm aus und mach mit dem linken Bein den Mikazuki Geri. Setze anschließend kontrolliert ab und geh mit links in dem Empi über.
Hat es funktioniert? Auf Anhieb? Oder gab’s Wackler im Unterbau?
Deshalb:
- Techniken spiegeln
- Andersherum rotieren
- Bewegungen rückwärts durchführen
- Mit rechts starten
- Bewusst die ungewohnte Seite trainieren
Es ist ungewohnt, ja. Aber genau das ist der Punkt: Bewegung bewusst durchführen und erleben, statt abzuspulen. So werden wir flexibler – mental wie auch körperlich.

Der Prüferlehrgang, Punkte und Emotionen
Nach dem Training ging in den zweiten Teil des Tages: Der Prüferlehrgang 2025 des SKV.
Teilgenommen haben zahlreiche A-, B- und C-Prüfer sowie interessierte Karateka ohne Prüferlizenz.
Nach einem kurzen Abstecher in die Umkleiden begrüfte der Prüferreferent des SKV offiziell die Runde, lobte die rege Beteiligung und erläuterte des Hauptthema der Sitzung: Die neue Verfahrensordnung des Deutschen Karate Verbands und besonders die neuen Kriterienkataloge für Berechtigung zur Prüfung höherer Dan Grade sowie zur Erlangung der A-Prüferlizenz.
Anwesend waren neben Gottfried Graebner (SKV Stilrichtungsreferenten Shotokan) und Roman Adam (der bei der bundesweiten Prüferversammlung im Sommer anwesend war, durch die heutige Sitzung führte und die Kriterienkataloge erläuterte) auch Manfred Schlicher (SKV Lehr- und Ausbildungsreferent).
Ein Verband mit Rückgrat
Der Saarländische Karate Verband hat es Ende 2024 schon einmal geschafft, unzureichende Punkte in der neuen Verfahrensordnung des Deutschen Karate Verbands neu gestalten zu lassen. Ein Landesverband kann also Einfluss nehmen und etwas bewirken.
Nach einigen Anmerkungen zur Verfahrensordnung 2025 kamen wir zu den bereits erwähnten Kriterienkatalogen und ab hier wurde es besonders emotional. Diese Kataloge legen fest, dass man für die Zulassung (!) zu einer höheren Dan Prüfung und auch zur Beantragung der A-Prüferlizenz eine bestimmte Anzahl an Punkten ansammeln muss – ähnlich dem Credit System bei Studiengängen.
Ein Vergleich fiktiver (aber durchaus realistischer) Karateka macht es schnell überdeutlich (Danke an Franz-Josef L.):
Beispiel 1
Ein 45-jähriger Karateka, seit 5 Jahren im erweiterten Vorstand seines Landesverbandes (2 Punkte), hat vor 20 Jahren seine Wettkampfkarriere beendet, war 4 Jahre lang Kadermitglied im Landeskader (2 Punkte), hatte auf Landesebene 3 x 2. Plätze erreicht (2 Punkte), und war sogar 1 x 3. bei DKV-Meisterschaften (3 Punkte). Mittlerweile ist er Landeskampfrichter (4 Punkte) und sein mitgliedsstarker Verein hat eine Meisterschaft auf Bundesebene organisiert (3 Punkte).
→ Gesamt: 16 Punkte – zur 6. DAN-Prüfung zugelassen
Beispiel 2
Eine 45- jährige Karateka ist seit 19 Jahren ununterbrochen Vereinsvorsitzende (2 Punkte) in einem Verein mit 90 Mitgliedern (2 Punkt), darunter 10 DAN-Träger (1 Punkt)
Seit 25 Jahren ist sie als Vereinstrainerin aktiv (3 Punkte) und besitzt eine C+B-Trainerlizenz (2 Punkte). Zusätzlich hat sie sich zur Karatelehrerin und zu einer Gesundheitslehrerin (2 x 2 Punkte) ausbilden lassen, was sie einschließlich der Lehrgänge zur Verlängerung der Lizenzen bisher mehr als 2000 € gekostet hat.
→ Gesamt: 14 Punkte – zur 6. DAN-Prüfung nicht zugelassen.
Die Reaktionen der Anwesenden? Kritisch. Emotional. 100% Einstimmig.
Alle sind sich einig: Diese Punkte Logik widerspricht dem Geist des Karate.
Ein Land das zusammensteht.
Nach gut 90 Minuten Austausch und Diskussion endet der Prüferlehrgang mit einem klaren Gefühl: Wir ziehen im Saarland an einem Strang. Unser Dank geht an alle Teilnehmer für die rege Beteilligung, die offene Diskussion und den großen Einsatz. Genau das macht einen Landesverband stark.
Und genau so gehen wir mit dem festem Vorsatz in die nächste Vorstandssitzung: Die Punkte werden weitergetragen. Diese Stimmen werden gehört.
Denn am Ende sind wir alle gleich: Wir sind Karateka.
Menschen, die Karate in ihr Leben aufgenommen haben und diesen Weg mit Leiderschaft und Begeisterung gehen.
Und wenn diese Leidenschaft nicht zählt, wenn sie nicht über den nächsten Weg auf dem Karate-Do entscheidet – was dann? Politik? Machterhalt? Kollektiver Egoismus?

Mein persönliches Fazit
Für mich war dieser Tag mehr als Training. Es war ein Erlebnis. Eine Erinnerung. Eine Einladung, Karate noch bewusster zu leben und zu erleben.
Ich freue mich auf das nächste Grundlagentraining.
Ich freue mich auf den nächsten besonderen Lehrgang am 25. September (meldet euch an).
Ich freue mich auf den nächsten Austausch zwischen Menschen, die für Karate genau so brennen wie ich.
Und ich freue mich vor allem darüber, Teil eines Verbandes zu sein, der mitdenkt, hinterfragt und gemeinsam weitergeht.
Karate und auch der Deutsche Karate Verband lebt von seinen Mitgliedern, die ihre freie Zeit für Karate aufbringen und dem mit Leidenschaft nachgehen. Die Mitglieder, die Kinder, Jugendliche und Erwachsene jeden Tag für das begeistern, was uns alle verbindet: Karate.
Und wenn das weniger wert ist, als ein paar Medaillen und Vorstandstitel… dann wird das Ergebnis auf lange Sicht sehr einfach sein: Die Karateka werden sich einen Verband suchen, der ihren Weg nicht künstlich ausbremst oder gar beendet.